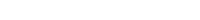Nik Thoenen, Gewinner des Wettbewerbs im Gespräch
Sabine Dreher: Welche Beziehung hast du persönlich zur Briefmarke bzw. zur Post?
Nik Thoenen: Ich war Postbeamter. Meine erste berufliche Station war eine Ausbildung zum Verwaltungssekretär bei der Schweizer Post, aber es war mir schnell klar, dass das nicht mein Traumberuf ist. Danach changierte ich zwischen Schauspielerei und Gestaltung. Dabei hat mich immer die Bandbreite interessiert, das Überschreiten der Disziplinen. Kunst spielt deswegen bis heute eine zentrale Rolle für mich. Mich hat nie ausschließlich nur ein Bereich interessiert.
SD: Ist für dich der Umstand, dass mit diesem Projekt zwei Stränge aus deiner Biografie zusammenkommen, die Post und die Gestaltung, ein später Zufall oder hast du dich schon früher speziell für Briefmarken interessiert?
NT: Nein, die Briefmarke an sich hat für mich nie eine besondere Rolle gespielt. Viel mehr interessieren mich die Wertzeichen, die aus dem Automaten kommen oder die aufgestempelt werden, weil ich das für das zeitgemäße Prinzip halte. Die klassische Marke verstehe ich als eine Form der Illustration. Ich habe mich auch im Zuge dieses Wettbewerbs nicht damit auseinandergesetzt, wie die Briefmarke technisch funktioniert. Ich habe mir allerdings einige schweizer, holländische und englische Beispiele angesehen, die mich begeistern, weil sie das Format sprengen.
SD: War für dich die Vorgabe des Formats von 31 x 31 Millimetern deshalb eine akzeptable Größe, weil du die Ausschreibung von vornherein als illustrative Aufgabe interpretiert hast?
NT: Für mich sind dabei zwei Aspekte zusammen gekommen: Ein Teil meiner Diplomarbeit war eine Plakatserie für eine Designausstellung. Mein Professor sagte mir, es seien schöne Bilder, aber sie funktionieren nicht als Plakate. Was ich hier auf 31 Millimetern zusammengefasst habe, entspricht eigentlich nicht dem, was eine Briefmarke erfüllen muss. Meine Marke ist viel zu dicht, zu überladen, zu illustrativ. Man muss das Bild eigentlich mit der Lupe studieren. Normalerweise ist es mein erster Impuls bei einem Wettbewerb aus dem Rahmen des Briefings auszubrechen, aber in diesem Fall habe ich anders reagiert, indem ich alle Anforderungen erfüllt habe. Es war mir wichtig, eine Botschaft zu kommunizieren, auch wenn ich sonst lieber abstrakt agiere.
SD: Demnach hast du etwas gemacht, von dem du wusstest, dass es hinsichtlich der Dichte an Information für das Format einer Briefmarke grenzwertig ist. Wie stehst du zum Endprodukt? Denkst du, dass es als Briefmarke funktioniert?
NT: Natürlich funktioniert die Marke, weil sie die wesentlichen Anforderungen erfüllt. Das E-Krönchen auf dem »O« ist ein erster grafischer Aufhänger, dahinter kommt die Bergkulisse und es tut sich immer mehr Raum auf für Assoziationen. Für Philatelisten erschließt sich die Marke mit einer Lupe thematisch noch viel weiter. Sie ist keine bunt strahlende Marke, aber sie ist inhaltlich stark aufgeladen. Am Horizont wird sie heller, da tut sich ein Hoffnungsschimmer auf. An sich finde ich rein typografische Lösungen viel spannender. Ein Entwurf wie der von Stefan Gandl entspricht viel mehr meinem gestalterischen Ansatz.
SD: Mit dem Krönchen auf dem »O« entlarvst du ein wenig deine Herkunft. Du bist Schweizer und hast dort eine Ausbildung zum Gestalter absolviert, lebst aber seit 15 Jahren in Wien. Hat diese typografische Intervention für dich eine ironische Komponente?
NT: Die Geschichte der Monarchie ist in Österreich immer vorhanden. Das typografische Spiel mit zwei Buchstaben hat mich in diesem Zusammenhang besonders amüsiert. Rückblickend hätte das »O« und das »E« alleine auch schon genügen können. Auch das Bild alleine hätte genügen können, aber ich konnte bei diesem Entwurf kein Element loslassen, weil ich nicht wusste, welches.
SD: Da in der Diskussion zum Briefmarkendesign internationale Beispiele, vor allem aus den Niederlanden und der Schweiz, oft strapaziert werden, war es für die Jury plausibel, dass ein Schweizer den Wettbewerb zur »Marke Österreich« gewinnt. Siehst du in deiner Schweizer Herkunft einen gewissen Vorteil?
NT: Auf jeden Fall, aber hauptsächlich deshalb, weil ich mir den Blick von außen bewahrt habe, obwohl ich schon seit 15 Jahren hier lebe. Aus meiner Sicht ist das ein Vorteil. Ich möchte keine Briefmarke mit der gleichen Themenstellung für die Schweiz realisieren müssen. Als Österreicher hätte ich vielleicht ganz banal ein Schnitzel in Österreich-Form paniert, ohne Perspektive einfach nur den Ist-Zustand festgehalten: paniert und in die Pfanne gehauen. Von außen kommend wäre so ein Kommentar herablassend und ich würde ihn mir deshalb nicht erlauben.
SD: In unserem Briefing haben wir ja dezidiert nach kritischen, aber eben gleichzeitig auch positiven Zugängen gefragt, denn wir alle wissen, es ist leicht etwas zu kritisieren, aber schwierig etwas Gutes zu machen.
NT: Bei der Betrachtung der Beiträge war für mich interessant, wie unterschiedlich die Blickrichtungen waren. Welche Entwürfe hatten deskriptiven Charakter? Wo wurden Wunschvorstellungen formuliert? Der Beitrag von Herbert Winkler beispielsweise repräsentiert eine Tradition, die ich Österreich zwar wünschen würde, die aber nicht den Tatsachen entspricht. Meine Marke ist stilistisch gesehen ein Retro-Produkt.
SD: Welche Beiträge aus der Serie sind dir als »Presse am Sonntag«-Leser im Gedächtnis geblieben?
NT: Den Entwurf von Stefan Gandl mit der passenden grafischen Umsetzung und der weiterführenden Idee fand ich sehr fein, auch wenn ich nicht weiß, ob sie als Marke funktionieren würde. Eine Marke, die sicher nie funktionieren würde, die mich aber herrlich amüsiert hat, war die »Nabelschau« von Circus. »Vichy« von Rainer Dempf hat mir in ihrer simplen, einfach dahin gelegten Geste gut gefallen, gerade weil in Österreich vielleicht niemand weiß, dass das Rot-Weiß-Muster »Vichy« heißt. Speziell aufgefallen ist mir noch die Marke von Alex Wiederin, die über den Rand hinausgeht. Das sind Beiträge, die ich als Gestalter schätze. Teilweise negativ aufgefallen ist mir das typografische Niveau einiger Beiträge. Es hat mich fast geschreckt, dass es bei einigen keine Rolle zu spielen scheint, wie die Schrift auf die Marke gesetzt wird. Dieses Manko hat vielleicht mit der österreichischen Tradition in diesem Bereich zu tun.
SD: Empfindest du es als eine Auszeichnung, als Gestalter eine Briefmarke zu realisieren?
NT: Als Gestalter befasse ich mich neben Schriftgestaltung hauptsächlich mit Buchgestaltung, da spielen immer vielschichtige Momente mit. Es ist nicht nur das Deckblatt, nicht nur der Umschlag, sondern es geht um eins. Bei der Briefmarke ist das sehr wohl ähnlich. Es geht nicht nur um die Briefmarke, sondern auch um den Träger und den Umgang damit. Wir haben eine Briefmarke hergestellt, die man noch mit der Zunge benetzen kann. Dass es so etwas noch gibt, ist verblüffend. Man leckt somit sozusagen das Bild Österreich. Für mich ist die Frage interessant, ob die Briefmarke für den Brief noch das richtige Medium ist. Eine Reihe ist natürlich spannender als die einzelne Marke, wie zum Beispiel die neue Serie der Post mit Architekturbeispielen belegt: die reduzierten Strichgrafiken, alles in Schwarz auf changierenden farbigen Untergründen. Da entfalten sich andere Möglichkeiten.
SD: Das war natürlich beim Briefing ein Aspekt, der einigen Teilnehmern gefehlt hat, die lieber einen Bogen oder eine Serie gestaltet hätten.
NT: Umgekehrt entstehen manchmal gerade, wenn die Einschränkungen stark sind, gute Ergebnisse. Die Aufgabenstellung, sich mit der Identität Österreichs auf einem so kleinen Format zu beschäftigen, war nicht einfach.
SD: Gehst du davon aus, dass deine Marke, wenn sie in Neuseeland, Japan, Bolivien oder Nigeria ankommt, Österreich zuordenbar ist? Was glaubst du zeichnet deine Marke als österreichische Marke aus?
NT: Meine Marke ist eine österreichische Marke für Österreicher. Die inhaltlichen Informationen sind nur nach innen verständlich. Nach außen funktioniert das plakative Motiv: Der Berg, der nicht der Großglockner ist, stellt den Alpenbezug her und das kann auch in Neuseeland gelesen werden. Außerdem steht ja auch Österreich drauf. Ich habe das Klischee bewusst eingesetzt, auch wenn ich persönlich den Schweizer Bergen in der Pannonischen Tiefebene entkommen wollte. Aus der touristischen Perspektive müsste der Himmel blau sein, aber vielleicht hat das nicht so schöne Wetter auf dem Bild emotional mehr mit Österreich zu tun, als eine strahlende Idylle. Ein Briefmarkenmotiv sollte eigentlich schnell lesbar und inhaltlich fassbar sein. Was ich gemacht habe, ist ein langsames, erzählerisches Produkt. Das entspricht dann eigentlich fast dem zeitlich aufwendigeren Postverkehr im Vergleich zur schnellen digitalen Post.
SD: Das heißt, deine Marke versteht sich eher als Beitrag zur Entschleunigung?
NT: Ja, wenn man so will. Auch wenn ich persönlich keine Sentimentalität hinsichtlich des Rückgangs des Briefverkehrs hege, würde mich schon interessieren, wie die Philatelisten meine Marke aufnehmen. Seit ich mich an diesem Wettbewerb beteiligt habe, beobachte ich die Produkte und Prozesse am Postschalter viel aufmerksamer als früher. Als Kulturgut halte ich die Briefmarke für extrem wichtig, auch weil damit ein spezieller Umgang gepflegt wird. Ich frage mich natürlich, wo die Entscheidung fällt, dass eine bestimmte Lokomotive auf eine Briefmarke kommt, oder wie es sein kann, dass auf so vielen Marken der Schriftzug Österreich einfach gesperrt gedruckt wird.
SD: Fällt dir spontan eine weitere Botschaft ein, die du gerne über eine Briefmarke kommunizieren möchtest?
NT: Nichts Konkretes. Aber ich denke, dass über die verstärkte Auseinandersetzung mit dem Thema Briefmarke, ihren Inhalten und fairen Prozessen bei der Vergabe eine gute Kultur entwickelt werden kann, die positiv nach außen wirkt. Denn nur wenn man etwas macht und es nach außen trägt, entsteht eine Diskussion. Was versteckt passiert, kann nicht wirken.